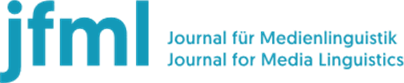
Vol 7 (2025), No 1: 1–9
DOI: 10.21248/jfml.2025.70
Rezension
Brommer, Sarah/Roth, Kersten
Sven/Spitzmüller, Jürgen (Hg.) (2022): Brückenschläge. Linguistik an den
Schnittstellen. Tübingen: Narr Francke Attempto (Tübinger Beiträge zur Linguistik,
583).
324 Seiten. € 78,00 ISBN 978-3-8233-8518-9
Festschriften sind schwierig. Ich kann dies auch aus eigener Erfahrung sagen (vgl. Holtfreter et al. 2022). Angefangen bei den üblichen Hürden der organisatorischen und finanziellen Planung, über das Akquirieren inhaltlich passender Forscher*innen, die gewillt sind, einen Text beizusteuern und sich an vorgegebene Deadlines halten, bis hin zu dem Versuch, sowohl der Forschungspersönlichkeit als auch dem Mensch an sich gerecht zu werden.
Zudem haben Festschriften oft einen schlechten Ruf. Sie sind Vorwürfen ausgesetzt, sie würden über wenig inhaltlich-thematische Kohärenz verfügen oder die Beiträge seien eher minderwertige ‚Nebenprodukte‘ der Autor*innen. Vielleicht auch wegen solcher Einschätzungen ist inzwischen meist gar nicht auf einen ersten Blick erkennbar, dass es sich um eine Festschrift handelt; neben dem zu rezensierenden Buch sei als weiteres Beispiel auf den ebenfalls erst auf einen zweiten Blick als Festschrift für Dietrich Busse erkennbaren Band von Martin Wengeler und Alexander Ziem von 2018 zu Diskurs, Wissen, Sprache verwiesen. Gleichzeitig scheinen solche Vorwürfe nicht vollkommen unbegründet und statt einer thematischen Kohärenz zwischen den Beiträgen erscheint es sinnvoller, eine einende Klammer durch Bezugnahmen auf die durch die Festschrift zu ehrende Person zu suchen. Dies ist in diesem Fall Christa Dürscheid. Weiterhin bedeutet dies, dass Leser*innen mit mehreren forschungsbereichsseitigen Schwerpunktsetzungen zu rechnen haben und nicht alle Texte den eigenen Forschungsinteressen entsprechen – auch wenn dies sicherlich bis zu einem gewissen Grad für nahezu alle Sammelbände gelten kann. Sich dies bewusst zu machen, lenkt die Rezeption in die wohl sinnvollste Richtung. Aus einer solchen Perspektive ist auch diese Rezension verfasst worden.
Die Festschrift für Christa Dürscheid versammelt neben den Herausgeber*innen Sarah Brommer, Kersten Sven Roth und Jürgen Spitzmüller 15 Autor*innen mit insgesamt 13 Beiträgen. Bis auf den letzten Text von Urs Bühler (vgl. S. 317–319), der aus journalistischer Perspektive Dürscheids wissenschaftskommunikative Öffentlichkeitsarbeit thematisiert, handelt es sich um wissenschaftliche Studien – oft mit einem eher theoretischen, denn empirischen Fokus.
In ihrer Einleitung Brückenschläge fachlich, menschlich wählen die Herausgeber*innen die beiden Konzepte des Brückenschlags und der Schnittstelle als geeignete Zugänge nicht nur zur Forschungspersönlichkeit Dürscheids, sondern auch zur inhaltlich-thematischen Konzeption des Bandes. Es ist hervorzuheben, dass sich viele Beitragende an diese einende Klammer gehalten haben und entweder schon in Titelüberschriften (z. B. Wo liegt die Schnittstelle zwischen der gesprochenen und der geschriebenen Sprache von Martin Neef oder Die Variantengrammatik des Standarddeutschen als Brückenschlag zwischen Areallinguistik und Grammatikographie von Stephen Elspaß) oder zu Beginn ihres Textes (z. B. „Im Zentrum dieses Beitrags steht ein mehrfacher Brückenschlag“ im Beitrag Manabu Watanabes auf S. 133) darauf Bezug nehmen. Auch schließen die meisten Texte explizit an Forschungen von Dürscheid an (z. B. zu Beginn der Beiträge von Stark; vgl. S. 27, Sutter und Bubenhofer; vgl. S. 113 oder Antos; vgl. S. 245). Lediglich einige wenige Aufsätze, wie die von Jan Georg Schneider und Katharina A. Zweig sowie Eva Neuland, haben einen eher vagen Bezug zu Dürscheid oder den Konzepten ‚Brückenschlag‘ und ‚Schnittstelle‘.
Die Herausgeber*innen verweisen in ihrer Einleitung auch auf das Brückenschlag- bzw. Schnittstellen-Verständnis Dürscheids, die dahingehend von der „Linguistik in Kommunikation“ (S. 11) spricht. Insgesamt zeichnet sich ihr einleitender Text durch eine empathische Darstellung ihres Verhältnisses zu Christa Dürscheid aus, die sie nicht nur als Wissenschaftlerin, sondern auch als Kollegin, Förderin und Fürsprecherin charakterisieren. Die Einleitung schafft es, Dürscheid nicht nur als fachlich relevante Forscherin zu präsentieren, sondern ebenso als sympathische Person. Dazu passt es, dass die Autor*innenenakquise wohl ohne Probleme ablief: „Egal, wen wir gefragt haben, ob sie:er bereit wäre, einen Text zu einer Festschrift für Christa Dürscheid beizusteuern, es kam stets postwendend die Antwort: ‚Für Christa immer‘“ (S. 13).
Die Festschrift startet mit einem eher allgemein gehaltenen essayistischen Plädoyer Warum es nur eine Linguistik gibt von Elisabeth Stark zur Verortung und Relevanz der Linguistik. Mit Bezug auf große Klassiker der Sprachwissenschaft, explizit erwähnt werden etwa de Saussure oder Coseriu (vgl. S. 21), geht die Autorin zuerst auf den „Markenkern“ (S. 20) der Linguistik ein, um danach Beispiele für gelungenes interdisziplinäres Arbeiten und die Funktion der Linguistik für Wissenschaft und Gesellschaft zu reflektieren. Sie schließt ihren launigen, wenn auch etwas oberflächlichen Text mit einer so nachvollziehbaren wie anschlussfähigen Beschreibung der Linguistik als potenzieller Brückenschlagsdisziplin (vgl. S. 35).
Die nachfolgenden drei Beiträge von Guido Seiler, Martin Neef und Stephan Elspaß sind über einen im weiten Sinne grammatischen Fokus inhaltlich geeint – daher wohl auch die Anordnung.
Guido Seiler erfasst und reflektiert in seinem Text Wie viele Kasus hat das Deutsche? aus eher theoretischer Perspektive grundsätzlich nachvollziehbar verschiedene Entwicklungstendenzen des deutschen Kasussystems, um daraus Erklärungen „für den Wegfall des Genitivs in den Dialekten“ (S. 59) abzuleiten, darunter jene, dass „das eigentlich Erklärungsbedürftige nicht der Wegfall des Genitivs“ (S. 60) sei, sondern „sein Erhalt in der Standardvarietät […], was sich aber daraus erklärt, dass das genitivische Allomorph als stilistischer Marker für Standardsprachlichkeit refunktionalisiert ist“ (S. 60). Zwar finden sich problemlos Bezüge zu Dürscheids grammatischen Arbeiten (vgl. S. 39), Aspekte des Brückenschlags und der Schnittstelle sind hingegen kaum auszumachen.
Einen solchen Bezug stellt Martin Neef in Satz für Satz her, der Gemeinsamkeiten aber vor allem Unterschiede der Erfassung von gesprochener und geschriebener Sprache thematisiert. Er schlägt innerhalb seiner ebenfalls theoretischen Ausführungen vor allem vor, die „schriftlinguistische Domäne unabhängig von der syntaktischen Einheit ‚Satz‘ zu definieren“ (S. 75) und stattdessen mit dem Konzept der Schreibäußerung als „eine[r] schriftlinguistische[n] Einheit, mit der ein kohärenter Gedanke ausgedrückt wird“ (S. 77), zu arbeiten. Dass es ihm eher um Trennendes, denn Einendes (Brückenschlagendes) geht, wird durch die Erklärung seines Vorschlags der Schreibäußerung deutlich: „Die strikte terminologische Trennung von Satz als syntaktischer Größe und Schreibäußerung als schriftlinguistischer Größe ermöglicht […] eine klarere Modellierung“ (S. 85).
Nach drei theoretischen Ausführungen ist der Beitrag Die Variantengrammatik des Standarddeutschen als Brückenschlag zwischen Areallinguistik und Grammatikographie von Stephan Elspaß der erste empirisch(er) ausgerichtete Text. Auch er startet mit Bezug zu Christa Dürscheid(s Projekt zur Variantengrammatik des Standarddeutschen; vgl. S. 89) und behandelt beispielhaft das Thema der Genuszuweisung bei substantivischen Anglizismen (vgl. S. 96–106). Es geht ihm auch darum, den Nutzen einer variantengrammatischen Perspektive herauszuarbeiten, da die „areale Variation […] lange Zeit ein blinder Fleck in der Grammatikographie [war]“ (S. 106). Der Brückenschlag zwischen Areallinguistik und Grammatikographie, der schon von Dürscheid vorgeschlagen wurde (vgl. S. 107), soll so, ausgehend von der klaren sowie einleuchtenden Argumentation des Autors, produktiv weitergeführt werden.
Indirekt schließen die Autor*innen des nächsten Textes Zwischen Empirie und Hermeneutik, Livia Sutter und Noah Bubenhofer, an die Überlegungen Elisabeth Starks zum Selbstverständnis der Linguistik an, indem sie die bis ins 19. Jahrhundert reichenden Identitätsreflexionen der Sprachwissenschaft als Geistes- oder Naturwissenschaft aufrufen (vgl. S. 111), um sich selbst als kulturlinguistische Korpuspragmatiker*innen zu verorten (vgl. S. 112). Mit Bezug auf das von Dürscheid angemahnte politolinguistische Forschungsdesiderat der Erfassung der Schweizer Politiklandschaft (vgl. S. 113) ist der Beitrag eine interessante Analyse der „Gebrauchsmuster“ (S. 126) sowie politischen Selbst- und Fremdverortungen anhand der Ausdrücke rechts und links (vgl. S. 114). Ausgehend von Bestimmungen der Verbindungen zwischen politikwissenschaftlichen und korpuspragmatischen Verständnissen von Bedeutung (vgl. S. 118) wird die Produktivität der Korpuspragmatik z. B. zur Topografie der Semantik herausgearbeitet (vgl. S. 120) und zuletzt, den in der Einleitung gesetzten Konzepten der Festschrift folgend, die Linguistik als Brückendisziplin zwischen Geistes- und Sozialwissenschaften bestimmt (vgl. S. 127).
Diesem stark pragmatisch-empirischen Beitrag Sutters/Bubenhofers folgt der wiederum theoretisch ausgerichtete Aufsatz Begegnung mit dem ‚Fremden‘ von Manabu Watanabe, der Möglichkeiten und Grenzen von Übersetzungen als hermeneutische bzw. interpretative Prozesse thematisiert. Es ist ein literaturwissenschaftlich geprägter Text, der sich auf Hans Georg Gadamers hermeneutische Überlegungen, die Kultursemiotik (vgl. S. 134) sowie, in etwas geringerem Maße, auf Wilhelm von Humboldt (vgl. S. 139) bezieht. Übersetzungen werden einerseits als Herausforderungen der interkulturellen Kommunikation verhandelt, um daran anschließend eine einende Perspektive abzuleiten, dass der/das Fremde als Bereicherung gesehen werden sollte (vgl. S. 149). Vor dem Hintergrund anderer kulturphilosophischer Ausführungen zu der Fremde/dem Fremden erscheint dieses Ergebnis allerdings etwas simplifizierend und komplexitätsreduziert – an dieser Stelle sei an die Ausführungen zu Grenzen der Begegnung des Ichs mit ‚dem Anderen‘ von Emmanuel Levinas erinnert, der die Verwundbarkeit (vgl. Levinas 2005: 95) zwischen Subjekt und Anderem betont, die in gegenseitige Inkommensurabilität, Unverständnis sowie Bedrohung und Vernichtung münden kann (vgl. Levinas 1983: 115). Auch fehlen Bezüge zu Dürscheid.
Ein solcher Bezug ist in Crispin Thurlows unterhaltsamen Beitrag zur Spracharbeit im Film wieder stärker gegeben, greift dieser doch Dürscheids Arbeiten zu kleinen Texten (vgl. S. 155) auf, um Untertitel von Filmen in diesem Sinne zu bestimmen (vgl. S. 165). Das Ganze findet gegebenenfalls unerwartet vornehmlich auf theoretischer Ebene statt. Vornehmlich referiert der Autor andere Studien (vor allem von Zdenek; vgl. S. 166–170; aber auch die textlinguistischen Arbeiten von Heiko Hausendorf und Ulrich Schmitz zu diesem Thema; vgl. S. 157–158) und stellt anhand dieser eine Art Forschungsprogramm zusammen, ohne selbst umfassend empirisch zu arbeiten. Er bezieht sich aber auf an anderen Stellen erfolgte Untersuchungen zu diesem Thema. Kleine Texte scheinen seit einiger Zeit ein textlinguistisch angesagter Forschungsgegenstand zu sein. Neben Hausendorfs Ausführungen (u. a. in seiner zusammen mit Wolfgang Kesselheim, Hiloko Kato und Martina Breitholz verfassten Monografie zur Textkommunikation von 2017) sei an den Sammelband Kleine Texte (2021 hrsg. v. Steffen Pappert und Kersten Sven Roth) erinnert. Man hätte sich, gerade aus medienlinguistischer Perspektive, noch eine etwas stärkere Reflexion des Status von Untertiteln (als kleine Texte) gewünscht – z. B. hinsichtlich ihrer intertextuellen Bezugnahme: Ist eine untertitelte Äußerung einer Figur schon ein Text? Wie grenzen sich die kleinen Texte dann aber bei komplexen Monologen ab? Man denke etwa an den einleitenden Monolog von Jesse Eisenberg (als Mark Zuckerberg) in The Social Network von 2010. Ist das ein Text? Dann wäre es aber wohl kein kleiner Text. Wenn aber einzelne untertitelte Äußerungen kleine Texte sind, wie grenzt man ab? Anhand ihrer Sichtbarkeit auf der Leinwand/dem Bildschirm? Zwar verweist der Autor auf einige dieser Zusammenhänge, auch mit Bezug auf Dürscheid Forschungen (vgl. S. 165), man hätte aber gerne noch mehr Überlegungen dazu gelesen.
Apropos Ulrich Schmitz: Nach Verweisen auf ihn durch Thurlow (s. o.) stammt der nächste Beitrag zu Design als symbolische Form von ihm selbst. Mit umfassendem Bezug auf Ernst Cassier bestimmt der Autor Design zunächst als gezielte Gestaltung (vgl. S. 181) sowie als Modalität der Differenz (vgl. S. 183), um dann das Zusammenspiel aus Sprache und Design genauer zu reflektieren. Ausgehend vom Beispiel eines Sachbuches (vgl. S. 192) sowie eines Auto-Cockpits (vgl. S. 195) leitet er die funktionale Aufgabenteilung der Informationsvermittlung zwischen Sprache und Design ab (vgl. S. 197) bzw. versteht beide „als symbolische Formen“ (S. 199), die eine „kooperative Arbeitsteilung ein[gehen], um eine verstehbare Einheit zu bilden“ (S. 199). Mit diesem Ergebnis wird auch ein Bezug zu einem der beiden Leitmotive der Festschrift – Brückenschlag – hergestellt. Darüber hinaus ist der Text ein schönes Beispiel für die Möglichkeiten der Implementierung kulturphilosophischer Konzepte auf linguistische Fragestellungen und Themen – auch wenn dafür der Bezug zu Dürscheid in den Hintergrund rückt.
Aus medienlinguistischer Perspektive ist der nächste Beitrag der wohl gehaltvollste. Heiko Hausendorf bestimmt darin auf so interessante wie nachvollziehbare, theoretische und empirische Art und Weise das Kommunikationsphänomen Telekopräsenz. Es ist m. E. der beste Text der Festschrift. Unter Telekopräsenz versteht der Autor videokonferenzbezogene Kommunikation (während der Corona-Zeit) vermittels der kommunikativen Parameter der Anwesenheit und Erreichbarkeit (vgl. S. 208–217). Ausgehend von einem an Goffman und Luhmann ausgerichteten Kommunikationsverständnis (vgl. S. 206) reflektiert Hausendorf zunächst auf theoretischer Ebene Kommunikation per Videokonferenz, um daran anschließend an Beispielen gesprächslinguistisch seine Überlegungen empirisch zu fundieren (vgl. S. 222). Auch Telekopräsenz zeichnet sich, so das Ergebnis seiner Auswertungen, durch inszenierte bzw. performierte Anwesenheit (vgl. S. 226–228), aber auch Abwesenheit (vgl. S. 229) aus und beruht damit auf Wahrnehmungswahrnehmung (vgl. S. 225). Bezogen auf die anfangs eingeführten Parameter bestimmt der Autor Telekopräsenz letztlich als „eine Form der ‚Kreuzung‘ von Anwesenheit und Erreichbarkeit“ (S. 236). Er schließt damit auch an Arbeiten Dürscheids zur Kommunikation im Internet an und verortet so seinen Beitrag produktiv im Kontext der Festschrift. Darüber hinaus ist es eine gut geschriebene, detailreiche, fast schon phänomenologische Bestimmung eines seit einigen Jahren gesellschaftlich relevant gewordenen Kommunikationsphänomens.
An diesen breit gefächerten (und insg. längsten) Aufsatz schließt ein wieder eher tentativ-reflektierender Beitrag von Gerd Antos zum Kommunikationsphänomen Meinung an. Einleitend motiviert der Autor seine Ausführungen in Bezug auf Dürscheids Forschungen zum digitalen Schreiben (vgl. S. 245), um danach das Themenfeld der (persönlichen) Meinung(säußerung) in (digitaler) Kommunikation zu umreißen (vgl. S. 246–249). Anhand Angaben zur Bestimmung sowie Funktionalität von Meinungen bzw. Meinungsäußerungen (vgl. S. 250-256) benennt er das eigentliche Ziel seines Textes als Werbung für eine linguistische Meinungsforschung (vgl. S. 261). Er verortet das Phänomen zwischen verschiedenen Polen, sieht Meinungen aber vor allem als „Symbole kommunikativer wie sozialer Macht“ (S. 263) und dahingehend als forschungsrelevant. In der Skizzierung einer Art von Forschungsprogramm schließt Antos an vorangegangene Texte mit ähnlichem Impetus, wie z. B. von Thurlow, an. Während der Bezug zu Dürscheid zumindest anfangs, wenn auch eher indirekt gegeben ist, erschließen sich Bezüge zu den Leitkonzepten der Festschrift hingegen eher weniger.
Ähnliches lässt sich auch zu den letzten beiden wissenschaftlichen Beiträgen der Festschrift sagen.
Zunächst plädieren Jan Georg Schneider und Katharina A. Zweig in Ohne Sinn für Grenzen des Einsatzes von E-Ratern, d. h. automatisierten Aufsatzbewertungssystemen (vgl. S. 272). Diese können zwar statistische Symptome erfassen, aber keine Kriterien der Qualitätsbewertung anwenden (vgl. S. 272) und stellen schon dahingehend ein kaum ausreichendes Surrogat zu menschlichen Begutachtungen dar. Anhand des Analyse- bzw. Textgegenstandes ‚Aufsatz‘ (vgl. S. 281) verweisen Schneider/Zweig auf eine weitere Herausforderung für E-Rater: die Kulturabhängigkeit von Aufsätzen erfassen zu können (vgl. S. 285). Zentraler Kritikpunkt liegt für die Autor*innen in der limitierten Fähigkeit von E-Ratern, nur „Bewertungsvorhersage[n], genauer gesagt eine Notenvorhersage“ (S. 285, Herv. im Orig.) zu generieren. Wesentliche Sprechakte bzw. Sprechaktteile des Bewertens und Benotens können so aber nicht gewonnen werden (vgl. S. 286–287). Streng genommen können E-Rater nicht einmal den Sprechakt der Vorhersage vollziehen (vgl. S. 289). Komplexere Kompetenzen sind dann eh allein menschlichen Akteuren vorbehalten bzw. „sind dazu nur Personen in der Lage, denen diese Kompetenz vom jeweiligen Kollektiv aufgrund von Qualifikationen oder anderen Vorleistungen zuerkannt wurden“ (S. 290). Es ist ein begründet technologiekritischer Beitrag, dessen Fokus auf die sprechakttheoretisch unterlegte Komplexität der Benotung und Bewertung in Bezug auf neuere technische Entwicklungen so mahnend wie nachvollziehbar erscheint – auch wenn nur indirekt ein Bezug zu Dürscheid oder den Leitkonzepten der Festschrift hergestellt wird.
Auch im Beitrag Eva Neumanns zur Sprachlichen Höflichkeit finden sich diese Bezüge lediglich indirekt. Sowohl mit Bezug auf die gesellschaftliche Relevanz des Themas ‚Höflichkeit‘ (vgl. S. 295) als auch auf die bestehende linguistische Höflichkeitsforschung (vgl. S. 296–297) thematisiert Neumann das sprachdidaktische Thema der Rolle der Höflichkeit in schulischer Kommunikation. Anhand Schüler*innen- und Lehrer*innenerhebungen zur jeweiligen Einschätzung der Relevanz von Höflichkeit sowie kontrastierend unter Hinzuziehung von Rahmenvorgaben und Lehrbüchern (vgl. S. 304) erfasst die Autorin die interessante Diskrepanz, dass Höflichkeit anhand der Erhebungen von Schüler*innen wie Lehrer*innen als wichtig eingeschätzt, aber in den Rahmenvorgaben und Lehrwerken für den Unterricht kaum berücksichtigt oder gar vermieden wird (vgl. S. 313) – ein interessanter Einblick in die Heterogenität und Komplexität schulischen kommunikationsbezogenen Miteinanders aus der Perspektive unterschiedlicher Akteure sowie Textsorten.
Mit dem oben schon erwähnten journalistischen Kurzbeitrag (mit drei Seiten) von Urs Bühler zur Brückenbauerin Christa Dürscheid und ihrem Engagement in der Wissenschaftskommunikation endet der Band auf einer konstruktiven Note (es schließen sich lediglich biographische Angaben der Herausgeber*innen und Autor*innen an). Insbesondere hebt Bühler darin ihre fachliche Kompetenz und Bereitschaft, sich auf Journalist*innen einzulassen, hervor.
Weitere Hinweise auf Dürscheid, z. B. eine Publikationsübersicht, finden sich nicht; solche Übersichten sind inzwischen aber auch eher unüblich geworden.
Mit Brückenschläge – Linguistik an den Schnittstellen liegt ein, den Textsortencharakteristika der Festschrift entsprechend, inhaltlich, methodisch sowie textkonzeptionell breit aufgefächerter Band vor, dessen wohl primäres Ziel, das Herausarbeiten der Relevanz und Anschlussfähigkeit der Forschungen Christa Dürscheids, auf jeden Fall erfüllt wird. Betrachtet man die einzelnen Beiträge im Überblick, so fallen einerseits konzeptionelle Unterschiede im Hinblick auf die Textsorten (zwischen Essay, Plädoyer, empirischer Untersuchung und weiteren Zwischenformen), aber andererseits ebenso Unterschiede im Hinblick auf inhaltliche Schwerpunktsetzungen (z. B. im systemlinguistischen Bereich der Grammatikforschung) auf. Positiv ist hervorzuheben, dass viele Autor*innen in ihren Beiträgen tatsächlich versuchen, Beziehungen zu den im Titel der Festschrift prominent gesetzten Konzepten des Brückenschlags und der Schnittstelle herzustellen. Dass sich diese Bezüge nicht in allen Beiträgen ausmachen lassen, ist ebenso der Textsorte geschuldet.
Aus dezidiert medienlinguistischer Perspektive erscheinen einzelne Texte besonders relevant, wobei neben dem schon hervorgehobenen Beitrag Hausendorfs die Ausführungen von Thurlow oder Schneider/Zweig angeführt werden können.
Interdisziplinär Interessierte dürften ob des gewählten Titels unter Umständen etwas enttäuscht werden. Trotz aller interdisziplinärer Bezüge verbleiben die Texte zumeist im Bereich der Linguistik bzw. arbeiten deren Relevanz als einer Art Brückenschlagsdisziplin heraus. Daher werden wohl für die meisten Leser*innen, je nach eigener fachwissenschaftlicher Verortung und eigenen Fachinteressen, nur einzelne Texte relevant erscheinen.
Für Christa Dürscheid hingegen dürfte der Band eine schöne Lektüre sein, die deutlich ihre forschungsseitige, aber auch persönliche Bedeutung für die linguistische Community unter Beweis stellt.
Literatur
Hausendorf, Heiko/Kesselheim, Wolfgang/Kato, Hiloko/Breitholz, Martina (2017): Textkommunikation. Ein textlinguistischer Neuansatz zur Theorie und Empirie der Kommunikation mit und durch Schrift. Berlin, Boston: De Gruyter.
Holtfreter, Susan/Kroll, Iris/Lisek, Grzegorz/Markewitz, Friedrich (Hg.) (2022): Sprache – Text – System. Festschrift zum 65. Geburtstag von Christina Gansel. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
Levinas, Emmanuel (2005): Humanismus des anderen Menschen. Hamburg: Felix Meiner.
Levinas, Emmanuel (1983): Die Spur des Anderen. Untersuchungen zur Phänomenologie und Sozialphilosophie. Freiburg im Breisgau: Karl Alber.
Pappert, Steffen/Roth, Kersten Sven (Hg.) (2021): Kleine Texte. Frankfurt a. M. etc.: Peter Lang.
Wengeler, Martin/Ziem, Alexander (Hg.) (2018): Diskurs, Wissen, Sprache. Linguistische Annäherungen an kulturwissenschaftliche Fragen. Berlin, Boston: De Gruyter.